 In seiner Stellung zur Natur ist der moderne Mensch in eine geistesgeschichtliche Wandlung hineingestellt, die dazu angetan ist, ihn fortwährend zu beunruhigen und von einem Extrem ins andere zu werfen. Er sieht im allgemeinen nur zwei Möglichkeiten vor sich: entweder eine idealistisch-romantische Naturverklärung oder eine realistisch-naturalistische Naturentleerung. Das eine Mal geht der Mensch von sich aus und sucht in der Natur sich selbst mit all seinen geistigen Anliegen wiederzufinden. Das andere Mal geht er von der Natur aus, begreift sie als einen ganz in sich, auf eigenen Gesetzen ruhenden Wirklichkeitsbereich und glaubt ihr nur so gerecht werden zu können, daß er ihr gegenüber auf allen geistigen Anspruch verzichtet. Auf beiden Wegen wirkt die Natur auf die menschliche Lage zurück. Im ersten Falle wird der Mensch sich von der Natur her gerade in seinen geistigen Bedürfnissen anerkannt und gesteigert fühlen. Im anderen Falle wird der Blick auf die Natur ihn unfehlbar auf die naturhafte Seite seiner Existenz zurückwerfen und geistig entmutigen. Das eine Mal wird gewissermaßen die Natur am Menschen, das andere Mal der Mensch an der Natur gemessen. In seiner Stellung zur Natur ist der moderne Mensch in eine geistesgeschichtliche Wandlung hineingestellt, die dazu angetan ist, ihn fortwährend zu beunruhigen und von einem Extrem ins andere zu werfen. Er sieht im allgemeinen nur zwei Möglichkeiten vor sich: entweder eine idealistisch-romantische Naturverklärung oder eine realistisch-naturalistische Naturentleerung. Das eine Mal geht der Mensch von sich aus und sucht in der Natur sich selbst mit all seinen geistigen Anliegen wiederzufinden. Das andere Mal geht er von der Natur aus, begreift sie als einen ganz in sich, auf eigenen Gesetzen ruhenden Wirklichkeitsbereich und glaubt ihr nur so gerecht werden zu können, daß er ihr gegenüber auf allen geistigen Anspruch verzichtet. Auf beiden Wegen wirkt die Natur auf die menschliche Lage zurück. Im ersten Falle wird der Mensch sich von der Natur her gerade in seinen geistigen Bedürfnissen anerkannt und gesteigert fühlen. Im anderen Falle wird der Blick auf die Natur ihn unfehlbar auf die naturhafte Seite seiner Existenz zurückwerfen und geistig entmutigen. Das eine Mal wird gewissermaßen die Natur am Menschen, das andere Mal der Mensch an der Natur gemessen.
 Diese Schwankungen in der Naturauffassung haben keineswegs nur theoretische Bedeutung, sondern bestimmen das moderne Lebensgefühl auf das Tiefste und tragen mit zu der inneren Richtungslosigkeit bei, die unserem ganzen Leben das Gepräge gibt. Diese Schwankungen in der Naturauffassung haben keineswegs nur theoretische Bedeutung, sondern bestimmen das moderne Lebensgefühl auf das Tiefste und tragen mit zu der inneren Richtungslosigkeit bei, die unserem ganzen Leben das Gepräge gibt.
 In diesem Sinn, meinen wir nun, sei das Wort des Paulus vom „ängstlichen Harren der Kreatur” (Röm. 8,19) von ganz besonderer Bedeutung für uns. Die eigentümliche Größe dieses Wortes liegt darin, daß es auf der einen Seite all die Seiten des Naturlebens zu umfassen vermag, die den modernen Menschen leicht einem öden Naturalismus in die Arme treiben und daß auf der anderen Seite der unerbittliche Realismus mit dem hier jede Naturvergötterung abgewehrt ist, doch zugleich in eine letzte Tiefe des Naturgeheimnis hineinschauen läßt, in der die Natur sich wieder mit der tiefsten geistigen Sehnsucht des Menschen begegnet, wie sie in allem idealistischen Aufschwung des Menschen um Ausdruck ringt. In diesem Sinn, meinen wir nun, sei das Wort des Paulus vom „ängstlichen Harren der Kreatur” (Röm. 8,19) von ganz besonderer Bedeutung für uns. Die eigentümliche Größe dieses Wortes liegt darin, daß es auf der einen Seite all die Seiten des Naturlebens zu umfassen vermag, die den modernen Menschen leicht einem öden Naturalismus in die Arme treiben und daß auf der anderen Seite der unerbittliche Realismus mit dem hier jede Naturvergötterung abgewehrt ist, doch zugleich in eine letzte Tiefe des Naturgeheimnis hineinschauen läßt, in der die Natur sich wieder mit der tiefsten geistigen Sehnsucht des Menschen begegnet, wie sie in allem idealistischen Aufschwung des Menschen um Ausdruck ringt.
 Was für Tatsachen sind es, die uns in diesem Sinne vom Seufzen der Kreatur reden lassen? Es sei an dreierlei erinnert. Was für Tatsachen sind es, die uns in diesem Sinne vom Seufzen der Kreatur reden lassen? Es sei an dreierlei erinnert.
 Zunächst einmal an die Tatsache der Vergänglichkeit. Mir kam sie einmal in diesem Frühjahr in ganz unvermuteter Weise besonders stark zum Bewußtsein. Ich ging durch einen Laubwald, der noch vor kurzem winterlich kahl dagestanden hatte und nun in das duftigste Blättergrün gekleidet, also eben durch die wundersame Verwandlung hindurchgegangen war, die man sich vorher immer gar nicht vorstellen kann. Die Sonne spielte in den Kronen alter Eichen und Buchen. Vor einer mächtigen Buche blieb ich stehen. Sie wirkte wie ein Urbild junggewordenen Lebens, dessen Anblick unbeschreiblich belebte und fröhlich machte. Da fiel mein Blick auf ein angefressenes Blatt. Es war der erste Eindruck zerstörter Frühlingsschönheit, der mir in diesem Jahre zum Bewußtsein kam. Seitdem sind wenige Wochen vergangen. Die Blätter sind schon sommerlich dunkel getönt. Vorgestern mußte ich feststellen, daß an jenen Bäumen, soweit der Blick reicht, kaum ein Blatt mehr völlig unversehrt ist. Zunächst einmal an die Tatsache der Vergänglichkeit. Mir kam sie einmal in diesem Frühjahr in ganz unvermuteter Weise besonders stark zum Bewußtsein. Ich ging durch einen Laubwald, der noch vor kurzem winterlich kahl dagestanden hatte und nun in das duftigste Blättergrün gekleidet, also eben durch die wundersame Verwandlung hindurchgegangen war, die man sich vorher immer gar nicht vorstellen kann. Die Sonne spielte in den Kronen alter Eichen und Buchen. Vor einer mächtigen Buche blieb ich stehen. Sie wirkte wie ein Urbild junggewordenen Lebens, dessen Anblick unbeschreiblich belebte und fröhlich machte. Da fiel mein Blick auf ein angefressenes Blatt. Es war der erste Eindruck zerstörter Frühlingsschönheit, der mir in diesem Jahre zum Bewußtsein kam. Seitdem sind wenige Wochen vergangen. Die Blätter sind schon sommerlich dunkel getönt. Vorgestern mußte ich feststellen, daß an jenen Bäumen, soweit der Blick reicht, kaum ein Blatt mehr völlig unversehrt ist.
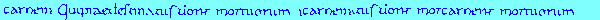
 So ungern wir naturgemäß schon im Mai auf solche Beobachtungen stoßen, so vergegenwärtigen sie uns doch unverkennbar eine Bedrohung, der alles naturgebundene Leben unterliegt. Es ist schließlich nichts anderes als die Grundtatsache der Vergänglichkeit, die uns da angreift. Wir bringen sie uns nicht gern zum Bewußtsein. Wir leben lieber in der ersten Jahreshälfte als in der zweiten. Wer gesteht sich gern ein, daß er die Mitte seines Lebens schon überschritten hat? Wer will nicht lieber jung sein als alt? Aber ein Entrinnen gibt es hier nicht. Sobald das Leben hervorgetreten ist, sieht es sich auch diesem Angriff des Todes und der Zerstörung ausgesetzt. So ungern wir naturgemäß schon im Mai auf solche Beobachtungen stoßen, so vergegenwärtigen sie uns doch unverkennbar eine Bedrohung, der alles naturgebundene Leben unterliegt. Es ist schließlich nichts anderes als die Grundtatsache der Vergänglichkeit, die uns da angreift. Wir bringen sie uns nicht gern zum Bewußtsein. Wir leben lieber in der ersten Jahreshälfte als in der zweiten. Wer gesteht sich gern ein, daß er die Mitte seines Lebens schon überschritten hat? Wer will nicht lieber jung sein als alt? Aber ein Entrinnen gibt es hier nicht. Sobald das Leben hervorgetreten ist, sieht es sich auch diesem Angriff des Todes und der Zerstörung ausgesetzt.
 Die andere Tatsache, die uns im Hinblick auf das Naturleben beunruhigen muß, hat vor allem der Begriff des „Kampfes ums Dasein” zum Bewußtsein gebracht. Diese Vorstellung ist so tief in unser Naturempfinden, ja in unser ganzes Lebensgefühl und von da aus selbst in die Kulturgestaltung eingegangen, daß hier zur Vergegenwärtigung aus einer großen Fülle von neuerdings aufgezeichneten Beobachtungen nur einige Beispiele herausgegriffen seien. Ernest Tompson Seton hat die „Geschichte einer Krähe” „Silberfleck” geschrieben, die auf jahrelangen Beobachtungen beruht. Alle Lebensschicksale einschließlich entzückender Äußerungen des Spieltriebes und rührender Beweise von Fürsorglichkeit beim Aufziehen der Brut, denen hier nachgegangen wird, sind von Gefahren überschattet, gegen die „Silberfleck” als „kommandierender General” einer Krähenarmee alle angeborene Intelligenz aufbietet - mit dem schließlichen Ergebnis, daß er dann doch eines Tages nach hitzigem Kampf und zum Schmerz seiner „Armee” einer Steineule zum Opfer fällt. Die andere Tatsache, die uns im Hinblick auf das Naturleben beunruhigen muß, hat vor allem der Begriff des „Kampfes ums Dasein” zum Bewußtsein gebracht. Diese Vorstellung ist so tief in unser Naturempfinden, ja in unser ganzes Lebensgefühl und von da aus selbst in die Kulturgestaltung eingegangen, daß hier zur Vergegenwärtigung aus einer großen Fülle von neuerdings aufgezeichneten Beobachtungen nur einige Beispiele herausgegriffen seien. Ernest Tompson Seton hat die „Geschichte einer Krähe” „Silberfleck” geschrieben, die auf jahrelangen Beobachtungen beruht. Alle Lebensschicksale einschließlich entzückender Äußerungen des Spieltriebes und rührender Beweise von Fürsorglichkeit beim Aufziehen der Brut, denen hier nachgegangen wird, sind von Gefahren überschattet, gegen die „Silberfleck” als „kommandierender General” einer Krähenarmee alle angeborene Intelligenz aufbietet - mit dem schließlichen Ergebnis, daß er dann doch eines Tages nach hitzigem Kampf und zum Schmerz seiner „Armee” einer Steineule zum Opfer fällt.
 Ein Bekannter, der in der Nähe eines großen Waldes wohnt, erzählte mir kürzlich, daß er sich nach langem Zögern zum Vernichtungsfeldzug gegen wildernde Katzen entschlossen habe, die derart unter den Singvögeln seines Gartens geräubert hätten, daß er sich schließlich zwischen Singvögeln oder Katzen habe entscheiden müssen. Ein Bekannter, der in der Nähe eines großen Waldes wohnt, erzählte mir kürzlich, daß er sich nach langem Zögern zum Vernichtungsfeldzug gegen wildernde Katzen entschlossen habe, die derart unter den Singvögeln seines Gartens geräubert hätten, daß er sich schließlich zwischen Singvögeln oder Katzen habe entscheiden müssen.
 Wenn man dabei noch einen Augenblick an die Entdeckungen der Bakteriologie denkt, die uns verstehen lehrt, daß dieser unablässige Kampf um die Existenz auch zwischen allerkleinsten Lebewesen in Bereichen des Daseins stattfindet, die jenseits unserer Wahrnehmungsfähigkeit liegen, und daß wir sozusagen aktiv oder passiv mit jedem Atemzug in diesen Kampf eingreifen, dann ist wieder deutlich, daß es sich hier um eine Grundtatsache des Naturlebens handelt, der wir uns auf keine Weise entziehen können. Wenn man dabei noch einen Augenblick an die Entdeckungen der Bakteriologie denkt, die uns verstehen lehrt, daß dieser unablässige Kampf um die Existenz auch zwischen allerkleinsten Lebewesen in Bereichen des Daseins stattfindet, die jenseits unserer Wahrnehmungsfähigkeit liegen, und daß wir sozusagen aktiv oder passiv mit jedem Atemzug in diesen Kampf eingreifen, dann ist wieder deutlich, daß es sich hier um eine Grundtatsache des Naturlebens handelt, der wir uns auf keine Weise entziehen können.
 Schließlich sei noch auf eine Erscheinung hingewiesen, in der sich uns die Natur vielleicht am unheimlichsten und undurchschaubarsten darstellt, das ist ihre unberechenbare Willkür und ihre herzlose Launenhaftigkeit. Wer vermöchte zu sagen, nach welchen Gesetzen dieselbe Natur, die eben nach Goethes herrlichem Mailied „Blüten aus jedem Zweig” hervorbrechen ließ, auch „den Reif in der Frühlingsnacht” bereit hält, von dem das Volkslied so ergreifend zu singen weiß. Eben berichtet die Zeitung von schweren Unwettern im Mitteldeutschland, die „Gärten und Felder unter Wasser gesetzt”, die „Bodenfläche teilweise weggeschwemmt” und „die gesamte Obst- und Gartenernte vernichtet” haben. Wer auf dem Lande lebt, weiß um die innere Spannung, in der hier der Mensch diesen Unberechenbarkeiten der Natur ständig gegenübersteht. Ich werde die Verzweiflung nie vergessen, mit der in einem der Hungerjahre der Nachkriegszeit ein Bauer mit mir die blühenden Pflaumenbäume ansah, auf die sich in der letzten Nacht eine schwere Schneelast gelegt hatte. Schließlich sei noch auf eine Erscheinung hingewiesen, in der sich uns die Natur vielleicht am unheimlichsten und undurchschaubarsten darstellt, das ist ihre unberechenbare Willkür und ihre herzlose Launenhaftigkeit. Wer vermöchte zu sagen, nach welchen Gesetzen dieselbe Natur, die eben nach Goethes herrlichem Mailied „Blüten aus jedem Zweig” hervorbrechen ließ, auch „den Reif in der Frühlingsnacht” bereit hält, von dem das Volkslied so ergreifend zu singen weiß. Eben berichtet die Zeitung von schweren Unwettern im Mitteldeutschland, die „Gärten und Felder unter Wasser gesetzt”, die „Bodenfläche teilweise weggeschwemmt” und „die gesamte Obst- und Gartenernte vernichtet” haben. Wer auf dem Lande lebt, weiß um die innere Spannung, in der hier der Mensch diesen Unberechenbarkeiten der Natur ständig gegenübersteht. Ich werde die Verzweiflung nie vergessen, mit der in einem der Hungerjahre der Nachkriegszeit ein Bauer mit mir die blühenden Pflaumenbäume ansah, auf die sich in der letzten Nacht eine schwere Schneelast gelegt hatte.
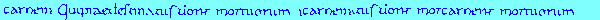
 Was aber die Tierwelt anlangt, so sei nur auf zwei Beispiele hingewiesen. E. Tompson Seton erzählt die Geschichte eines Schäferhundes Wulln, der die rührendsten Beweise von Treue, Intelligenz und Zuverlässigkeit erbracht hatte. Über diesen Hund kommt aus unerklärbaren Gründen eine unbezwingbare Mordlust, die ihn zum „blutdürstigen Wüterich bei Nacht” und, als er sich entdeckt sieht, beinahe zum Mörder seiner Herrin werden läßt. (Anm. 1) Was aber die Tierwelt anlangt, so sei nur auf zwei Beispiele hingewiesen. E. Tompson Seton erzählt die Geschichte eines Schäferhundes Wulln, der die rührendsten Beweise von Treue, Intelligenz und Zuverlässigkeit erbracht hatte. Über diesen Hund kommt aus unerklärbaren Gründen eine unbezwingbare Mordlust, die ihn zum „blutdürstigen Wüterich bei Nacht” und, als er sich entdeckt sieht, beinahe zum Mörder seiner Herrin werden läßt. (Anm. 1)
 Und Bengt Berg erzählt: „Zahme Schwäne können für kleinere Vögel, die ihren Aufenthalt in demselben engen eingezäunten Gewässer teilen, eine Geißel sein. Ein kleines Entenweibchen, das seine Jungen ausgeführt hat und zufrieden und ängstlich mit den kleinen Lebewesen daherschwimmt, kann sich von einem Höckerschwan hilflos gegen das Ufer hin abgeschnitten sehen. Er ist über nichts anderes zornig, als daß die Kleinen sich bewegen. Nach ein paar Schnabelhieben liegen in wenigen Augenblicken die meisten Jungen tot da, wo sie noch eben in toller Lebensfreude umherplätscherten, und der Schwan, der vielleicht unerwartet etwas Anderes sieht, was seine Neugierde lockt, schwimmt ruhig und königlich fort, als hätte er alles außer sich vergessen” (Anm. 2) Und Bengt Berg erzählt: „Zahme Schwäne können für kleinere Vögel, die ihren Aufenthalt in demselben engen eingezäunten Gewässer teilen, eine Geißel sein. Ein kleines Entenweibchen, das seine Jungen ausgeführt hat und zufrieden und ängstlich mit den kleinen Lebewesen daherschwimmt, kann sich von einem Höckerschwan hilflos gegen das Ufer hin abgeschnitten sehen. Er ist über nichts anderes zornig, als daß die Kleinen sich bewegen. Nach ein paar Schnabelhieben liegen in wenigen Augenblicken die meisten Jungen tot da, wo sie noch eben in toller Lebensfreude umherplätscherten, und der Schwan, der vielleicht unerwartet etwas Anderes sieht, was seine Neugierde lockt, schwimmt ruhig und königlich fort, als hätte er alles außer sich vergessen” (Anm. 2)
 Worin liegt diesen Tatsachen gegenüber nun die eigentümliche Hilfe, zu der das Wort des Paulus vom „ängstlichen Harren der Kreatur” leiten kann? Worin liegt diesen Tatsachen gegenüber nun die eigentümliche Hilfe, zu der das Wort des Paulus vom „ängstlichen Harren der Kreatur” leiten kann?
 1. Einmal ist hier die Natur radikal e n t g ö t t e r t . Die Natur ist in einer letzten Bedürftigkeit vor das innere Auge des Menschen gestellt. Und zwar nicht so, daß der Mensch sich ihr gegenüber als der Überlegene ausspielen könnte. Hier kommt das Bibelwort vielmehr allen natürlichen Empfindungen entgegen, die den Menschen auf seine Kleinheit der Natur gegenüber hinweisen. Er ist ja in all ihre Not verwickelt. Ihrem Fluch unterliegt auch er. Ein Kind des Todes ist auch er. Und er kann ja schließlich als auf sich selbst gestelltes endliches Lebewesen der ungeheueren Größe des Naturzusammenhanges gegenüber nur als punkthaft klein empfunden werden. Aber, so klein er der Natur gegenüber dastehen mag - sie ist für ihn doch nun, da ihm ihre tiefste Not aufgegangen ist, kein letzter Ausblick mehr - eben gerade weil er in ihr s e i n e Not wiederfindet, die die Not der Gottferne ist. So kann nun von der Natur her keine Notwende mehr erwartet werden. Die Natur ist nicht die Erlösung, sie b e d a r f selber der Erlösung. 1. Einmal ist hier die Natur radikal e n t g ö t t e r t . Die Natur ist in einer letzten Bedürftigkeit vor das innere Auge des Menschen gestellt. Und zwar nicht so, daß der Mensch sich ihr gegenüber als der Überlegene ausspielen könnte. Hier kommt das Bibelwort vielmehr allen natürlichen Empfindungen entgegen, die den Menschen auf seine Kleinheit der Natur gegenüber hinweisen. Er ist ja in all ihre Not verwickelt. Ihrem Fluch unterliegt auch er. Ein Kind des Todes ist auch er. Und er kann ja schließlich als auf sich selbst gestelltes endliches Lebewesen der ungeheueren Größe des Naturzusammenhanges gegenüber nur als punkthaft klein empfunden werden. Aber, so klein er der Natur gegenüber dastehen mag - sie ist für ihn doch nun, da ihm ihre tiefste Not aufgegangen ist, kein letzter Ausblick mehr - eben gerade weil er in ihr s e i n e Not wiederfindet, die die Not der Gottferne ist. So kann nun von der Natur her keine Notwende mehr erwartet werden. Die Natur ist nicht die Erlösung, sie b e d a r f selber der Erlösung.
 2. Erst wenn es so als völlig unmöglich erkannt ist, „Natur” ein Letztes sein zu lassen, kann deutlich werden, was es heißt, sich der Natur gegenüber auf Gott zu besinnen, ja in ihr Gott zu begegnen. Und dessen ist der Apostel mit seinem Wort vom „ängstlichen Harren der Kreatur” ja offenbar gewiß, eben von Gott her auch einen Blick in die l e t z t e T i e f e des Naturlebens tun zu können. So allein wird nun auch eine w i r k l i c h e Begegnung von Mensch und Natur möglich. Er begegnet nun in der Natur s e i n e r tiefsten Not, aber auch seiner Verheißung. Eben jener Verheißung, die dem zuteil wird, dem alle menschlichen Sicherungen so gründlich zerbrochen sind wie dem Mann, dem als das Ergebnis aller Selbstbeobachtung sich der Seufzer entrang: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?” (Röm. 7,24). Ihm begegnet nun in der Natur wirklich der Schöpfer. 2. Erst wenn es so als völlig unmöglich erkannt ist, „Natur” ein Letztes sein zu lassen, kann deutlich werden, was es heißt, sich der Natur gegenüber auf Gott zu besinnen, ja in ihr Gott zu begegnen. Und dessen ist der Apostel mit seinem Wort vom „ängstlichen Harren der Kreatur” ja offenbar gewiß, eben von Gott her auch einen Blick in die l e t z t e T i e f e des Naturlebens tun zu können. So allein wird nun auch eine w i r k l i c h e Begegnung von Mensch und Natur möglich. Er begegnet nun in der Natur s e i n e r tiefsten Not, aber auch seiner Verheißung. Eben jener Verheißung, die dem zuteil wird, dem alle menschlichen Sicherungen so gründlich zerbrochen sind wie dem Mann, dem als das Ergebnis aller Selbstbeobachtung sich der Seufzer entrang: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?” (Röm. 7,24). Ihm begegnet nun in der Natur wirklich der Schöpfer.
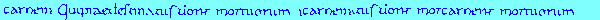
 Und damit kommt - wie bei dem Bestehen auf der radikalen Entgötterung der Natur das eigentliche Anliegen aller realistisch-naturalistischen Naturauffassung - so hier allein auch das innerste, freilich sich selbst nicht verstehende Anliegen aller romantisch-idealistischen Naturverklärung zu seinem Rechte. Sie will ja den Blick hinter die Vordergründe des Naturdaseins deshalb gewinnen, weil sie doch schließlich eine dunkle Empfindung von menschlicher Enge und Erlösungsbedürftigkeit hat - um freilich dann doch wieder in einer Vergötterung des Menschen hängen zu bleiben. Hier sind Mensch und Natur radikal gesehen, wie sie sind. Und nun erst öffnet sich der Blick in die l e t z t e n Zusammenhänge der Natur. Nun erst kann ihr Zusammenhang mit Gott und zugleich ihr Herausgeworfensein aus diesem Zusammenhang gesehen werden. Nun ist auch der allertiefste Wirklichkeitsgehalt der N a t u r : Sehnsucht nach Gott, Hinstreben zu Gott, Gerichtetsein auf Gott. Und damit kommt - wie bei dem Bestehen auf der radikalen Entgötterung der Natur das eigentliche Anliegen aller realistisch-naturalistischen Naturauffassung - so hier allein auch das innerste, freilich sich selbst nicht verstehende Anliegen aller romantisch-idealistischen Naturverklärung zu seinem Rechte. Sie will ja den Blick hinter die Vordergründe des Naturdaseins deshalb gewinnen, weil sie doch schließlich eine dunkle Empfindung von menschlicher Enge und Erlösungsbedürftigkeit hat - um freilich dann doch wieder in einer Vergötterung des Menschen hängen zu bleiben. Hier sind Mensch und Natur radikal gesehen, wie sie sind. Und nun erst öffnet sich der Blick in die l e t z t e n Zusammenhänge der Natur. Nun erst kann ihr Zusammenhang mit Gott und zugleich ihr Herausgeworfensein aus diesem Zusammenhang gesehen werden. Nun ist auch der allertiefste Wirklichkeitsgehalt der N a t u r : Sehnsucht nach Gott, Hinstreben zu Gott, Gerichtetsein auf Gott.
 3. Und jetzt endlich kann nun auch noch ein Wort vom Menschen und seiner Verantwortung der Natur gegenüber gesagt werden. Von hier aus kann die unerhörte Kühnheit dieser ganzen Perspektive dem modernen Bewußtsein vielleicht am ehesten verständlich werden. Dem Menschen sind hier zwei Aufgaben gestellt. Einmal die eines bis in die letzten Tiefen vordringenden, wahrhaft ehrfürchtigen Naturverständnisses. Es kann nur von der Gewißheit der Gotteskindschaft her gewonnen werden, so wie sie in Christus möglich geworden ist. Dem Menschen, der sich selbst als letzten Maßstab setzt, entschwindet unfehlbar der Mut, die Natur in der Tiefe ihrer Zerrissenheit und Not zu sehen. Wie sollte er solchem Seufzen der Kreatur aus eigenem Vermögen begegnen? Erst wenn er aus seiner eigenen Erfahrung weiß, was Sünde und Tod sind, und es wagt, sich selbst als „verlorenen und verdammten Menschen” zu begreifen, kann er die Größe des Verhängnisses sehen, die Sünde und Tod auch über die Natur gebracht haben. 3. Und jetzt endlich kann nun auch noch ein Wort vom Menschen und seiner Verantwortung der Natur gegenüber gesagt werden. Von hier aus kann die unerhörte Kühnheit dieser ganzen Perspektive dem modernen Bewußtsein vielleicht am ehesten verständlich werden. Dem Menschen sind hier zwei Aufgaben gestellt. Einmal die eines bis in die letzten Tiefen vordringenden, wahrhaft ehrfürchtigen Naturverständnisses. Es kann nur von der Gewißheit der Gotteskindschaft her gewonnen werden, so wie sie in Christus möglich geworden ist. Dem Menschen, der sich selbst als letzten Maßstab setzt, entschwindet unfehlbar der Mut, die Natur in der Tiefe ihrer Zerrissenheit und Not zu sehen. Wie sollte er solchem Seufzen der Kreatur aus eigenem Vermögen begegnen? Erst wenn er aus seiner eigenen Erfahrung weiß, was Sünde und Tod sind, und es wagt, sich selbst als „verlorenen und verdammten Menschen” zu begreifen, kann er die Größe des Verhängnisses sehen, die Sünde und Tod auch über die Natur gebracht haben.
 Wirkliches Verstehen der Natur ist also nur aus t i e f s t e r menschlicher Erschütterung heraus möglich. Der im biblischen Sinn des Wortes menschlichste Mensch wird der Natur am nächsten kommen. Man denke etwa an Franz von Assisi oder, um in entsprechendem Abstande nur ein Beispiel aus neuester Zeit zu nennen, an die Art, wie Julie Schlosser in der Erzählung „Das kleine Wunder” von ihrer Katze erzählt. (Anm. 3) Nur so, meinen wir, lasse sich eine neue Ehrfurcht der Natur gegenüber gewinnen, nur so die ganze Flachheit des Herrschaftsverhältnisses durchschauen, das sich der Mensch des Zeitalters der Technik der Natur gegenüber angemaßt hat. Wirkliches Verstehen der Natur ist also nur aus t i e f s t e r menschlicher Erschütterung heraus möglich. Der im biblischen Sinn des Wortes menschlichste Mensch wird der Natur am nächsten kommen. Man denke etwa an Franz von Assisi oder, um in entsprechendem Abstande nur ein Beispiel aus neuester Zeit zu nennen, an die Art, wie Julie Schlosser in der Erzählung „Das kleine Wunder” von ihrer Katze erzählt. (Anm. 3) Nur so, meinen wir, lasse sich eine neue Ehrfurcht der Natur gegenüber gewinnen, nur so die ganze Flachheit des Herrschaftsverhältnisses durchschauen, das sich der Mensch des Zeitalters der Technik der Natur gegenüber angemaßt hat.
 Über dieses Verstehen hinaus aber will auch die Verantwortung des Menschen zu neuer Liebe der Natur gegenüber anerkannt sein. Darüber vom Menschen her zu reden, ist offenkundig unmöglich - zumal in einer Zeit wie der unsrigen, in der in ganz besonders spürbarer Weise die menschliche Liebeskraft nicht einmal ausreicht, die Temperatur der Beziehungen zwischen M e n s c h u n d M e n s c h - man denke nur an die Völkerbeziehungen - über den Gefrierpunkt zu bringen. Auch hier aber wird „bei Gott möglich”, was „bei den Menschen unmöglich” ist. Der Mensch hat einfach anzuerkennen, daß er der Natur gegenüber auf Gott zurückgeworfen ist, wenn er nicht in Illusionismus oder geistige Erstarrung versinken will. Gott aber ist Liebe. Den Bedrohungen und Dämonien des Naturlebens ist zuletzt nur die Liebe gewachsen. Freilich nicht die Liebe des Menschen, der sich nun der Natur gegenüber in einer letzten Überhebung in Positur setzt; sondern des Menschen, der die ganze Größe seiner Abhängigkeit und Schuld anerkennt, und sich gleichwohl - o Wunder aller Wunder! - von Gottes Liebe geliebt und getragen weiß. Über dieses Verstehen hinaus aber will auch die Verantwortung des Menschen zu neuer Liebe der Natur gegenüber anerkannt sein. Darüber vom Menschen her zu reden, ist offenkundig unmöglich - zumal in einer Zeit wie der unsrigen, in der in ganz besonders spürbarer Weise die menschliche Liebeskraft nicht einmal ausreicht, die Temperatur der Beziehungen zwischen M e n s c h u n d M e n s c h - man denke nur an die Völkerbeziehungen - über den Gefrierpunkt zu bringen. Auch hier aber wird „bei Gott möglich”, was „bei den Menschen unmöglich” ist. Der Mensch hat einfach anzuerkennen, daß er der Natur gegenüber auf Gott zurückgeworfen ist, wenn er nicht in Illusionismus oder geistige Erstarrung versinken will. Gott aber ist Liebe. Den Bedrohungen und Dämonien des Naturlebens ist zuletzt nur die Liebe gewachsen. Freilich nicht die Liebe des Menschen, der sich nun der Natur gegenüber in einer letzten Überhebung in Positur setzt; sondern des Menschen, der die ganze Größe seiner Abhängigkeit und Schuld anerkennt, und sich gleichwohl - o Wunder aller Wunder! - von Gottes Liebe geliebt und getragen weiß.
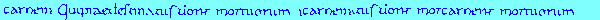
 Das ist nun eine Tatsache so ungeheurer Art, daß sie wenigstens durch zwei Hinweise unserem Verständnis angenähert sei. Einmal sei wieder an Franz von Assisi erinnert, dessen ganze Naturbeziehung in symbolischer Weise die hier an den Menschen ergehende Liebesforderung verkörpert und deshalb besonders deutlich erkennen läßt, wie hier alle Anerkennung menschlicher Verantwortung den Glauben an den seinsmäßigen Zusammenhang der Natur mit der Urmacht der Liebe voraussetzt. Und dann sei auf die Beobachtungen hingewiesen, die Peter Kropotkin in seinem Buch „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt” zusammengetragen hat. Sie erweisen jedenfalls, daß die Lehre vom „Kampf ums Dasein” nicht das Recht hat, sich als einzigen Schlüssel des Naturverständnisses zu betrachten, weil sich offenkundige Tatsachen des Naturlebens so überhaupt nicht erklären lassen. Das ist nun eine Tatsache so ungeheurer Art, daß sie wenigstens durch zwei Hinweise unserem Verständnis angenähert sei. Einmal sei wieder an Franz von Assisi erinnert, dessen ganze Naturbeziehung in symbolischer Weise die hier an den Menschen ergehende Liebesforderung verkörpert und deshalb besonders deutlich erkennen läßt, wie hier alle Anerkennung menschlicher Verantwortung den Glauben an den seinsmäßigen Zusammenhang der Natur mit der Urmacht der Liebe voraussetzt. Und dann sei auf die Beobachtungen hingewiesen, die Peter Kropotkin in seinem Buch „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt” zusammengetragen hat. Sie erweisen jedenfalls, daß die Lehre vom „Kampf ums Dasein” nicht das Recht hat, sich als einzigen Schlüssel des Naturverständnisses zu betrachten, weil sich offenkundige Tatsachen des Naturlebens so überhaupt nicht erklären lassen.
 Kropotkins Nachweise erhalten eine eigentümliche Bestätigung durch die Erfahrungen, die ein so nüchterner Beobachter wie Carl Hagenbeck im Umgang mit wilden Tieren gemacht hat. In seiner Lebenssituation lag sicher keine Versuchung zur Sentimentalität. Er war Tierhändler und Dresseur zu einer Zeit, in der die Gewaltdressur noch als einzige Möglichkeit des Umgangs mit wilden Tieren galt. Hagenbeck findet nun, daß „die meisten großen Raubtiere von Natur gutmütig sind” und daß das Verlangen nach Freundschaft in ihnen ebenso mächtig ist wie die Angst um ihr Leben und die daraus hervorbrechende Feindseligkeit. So erzählt er von einem Tiger, den er einmal gesund gepflegt hatte und der ihm daraufhin - längst in anderen Besitz übergegangen - „bis zu seinem Tode” „die treueste Anhänglichkeit bewahrt” hat. „Häufig sah ich ihn lange Zeit nicht, er brauchte aber nur, und zwar unvorbereitet, meine Stimme aus der Ferne zu vernehmen, um gleich in freudige Erregung zu geraten Kam ich näher, so begann er zu miauen und zu schnurren, wie Katzen tun, um mich auf sich aufmerksam zu machen. Nicht eher gab sich das Tier zufrieden, bis ich herantrat und mich eine Weile mit ihm beschäftigte.” (Anm. 4) Dabei könnte es sich um eine bloße Kuriosität handeln. Indessen wird doch wohl so erst verständlich, wie es zu einer kulturgeschichtlich so fundamentalen Tatsache wie der Haltung von Haustieren hat kommen können. Kropotkins Nachweise erhalten eine eigentümliche Bestätigung durch die Erfahrungen, die ein so nüchterner Beobachter wie Carl Hagenbeck im Umgang mit wilden Tieren gemacht hat. In seiner Lebenssituation lag sicher keine Versuchung zur Sentimentalität. Er war Tierhändler und Dresseur zu einer Zeit, in der die Gewaltdressur noch als einzige Möglichkeit des Umgangs mit wilden Tieren galt. Hagenbeck findet nun, daß „die meisten großen Raubtiere von Natur gutmütig sind” und daß das Verlangen nach Freundschaft in ihnen ebenso mächtig ist wie die Angst um ihr Leben und die daraus hervorbrechende Feindseligkeit. So erzählt er von einem Tiger, den er einmal gesund gepflegt hatte und der ihm daraufhin - längst in anderen Besitz übergegangen - „bis zu seinem Tode” „die treueste Anhänglichkeit bewahrt” hat. „Häufig sah ich ihn lange Zeit nicht, er brauchte aber nur, und zwar unvorbereitet, meine Stimme aus der Ferne zu vernehmen, um gleich in freudige Erregung zu geraten Kam ich näher, so begann er zu miauen und zu schnurren, wie Katzen tun, um mich auf sich aufmerksam zu machen. Nicht eher gab sich das Tier zufrieden, bis ich herantrat und mich eine Weile mit ihm beschäftigte.” (Anm. 4) Dabei könnte es sich um eine bloße Kuriosität handeln. Indessen wird doch wohl so erst verständlich, wie es zu einer kulturgeschichtlich so fundamentalen Tatsache wie der Haltung von Haustieren hat kommen können.
 Aber wie dem immer sei: die Rede vom „Seufzen der Kreatur” geht uns heute, wie mir scheint, wieder in besonderer Weise an. Alle Möglichkeiten vom Idealismus oder vom Naturalismus her zu fruchtbarer Naturbeziehung zu kommen, sind erschöpft, weil sie auf einer ungenügenden Kenntnis der menschlichen Lage beruhen. Heute muß uns das Geschaffensein der Natur wie der Anspruch des Schöpfers an die Natur von neuem deutlich werden, weil so allein alle Abgründe des Naturlebens gesehen wie alle seine Verheißungen anerkannt werden können. So allein kann auch der weitverbreiteten Vorstellung gewehrt werden, als entfremde das Christentum der Natur, während es doch in Wirklichkeit dem tiefsten Sein, aber auch dem tiefsten Leid des Naturlebens Auge und Herz des Menschen öffnen will. Anspruch und Verheißung Gottes an die Natur aber kann nur der Mensch begreifen, der sich selbst als Geschöpf Gottes schuldig und zum Gehorsam gegen Gott verpflichtet weiß. Nach der Erlösung der Natur fragen, heißt nach der Erlösung des Menschen fragen. Nur dem seine eigene Lage zu tiefst begreifenden Menschen kann das Auge dafür aufgehen, daß „alle Kreatur sich mit uns sehnt und ängstet noch immerdar” (Röm. 8,22) und daß „das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes” (Röm. 8,19); nur er kann auch die Hoffnung gewinnen, daß auch die Natur „frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes” (Röm. 8,21). Aber wie dem immer sei: die Rede vom „Seufzen der Kreatur” geht uns heute, wie mir scheint, wieder in besonderer Weise an. Alle Möglichkeiten vom Idealismus oder vom Naturalismus her zu fruchtbarer Naturbeziehung zu kommen, sind erschöpft, weil sie auf einer ungenügenden Kenntnis der menschlichen Lage beruhen. Heute muß uns das Geschaffensein der Natur wie der Anspruch des Schöpfers an die Natur von neuem deutlich werden, weil so allein alle Abgründe des Naturlebens gesehen wie alle seine Verheißungen anerkannt werden können. So allein kann auch der weitverbreiteten Vorstellung gewehrt werden, als entfremde das Christentum der Natur, während es doch in Wirklichkeit dem tiefsten Sein, aber auch dem tiefsten Leid des Naturlebens Auge und Herz des Menschen öffnen will. Anspruch und Verheißung Gottes an die Natur aber kann nur der Mensch begreifen, der sich selbst als Geschöpf Gottes schuldig und zum Gehorsam gegen Gott verpflichtet weiß. Nach der Erlösung der Natur fragen, heißt nach der Erlösung des Menschen fragen. Nur dem seine eigene Lage zu tiefst begreifenden Menschen kann das Auge dafür aufgehen, daß „alle Kreatur sich mit uns sehnt und ängstet noch immerdar” (Röm. 8,22) und daß „das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes” (Röm. 8,19); nur er kann auch die Hoffnung gewinnen, daß auch die Natur „frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes” (Röm. 8,21).
Anmerkungen:
| 1: | Bingo und andere Tiergeschichten, Stuttgart. |
| 2: | Tookern, Der See der wilden Schwäne. Berlin 1929. S. 23. |
| 3: | In Opal, Berlin 1927. |
| 4: | Carl Hagenbeck, Von Tieren und Menschen. 106. - 110. Tausend, S. 203. |
Das Gottesjahr 1932, S. 50-56
© Bärenreiter-Verlag zu Kassel
|

