 Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.
 Was ist das? Was ist das?
 Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen. Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen.
 Wer Martin Luthers Auslegung mit dem ersten Artikel des christlichen Glaubens vergleicht, der spürt den ganzen Unterschied einer Welt, die sich einfach in ein Oben und Unten, Himmel und Erde, teilt, und jener Welt, wie sie der Mensch der Neuzeit sieht; Ich - samt allen Kreaturen; ich - und die übrigen geschaffenen Dinge mir gegenüber. Das kleine Ich - es war immer dagewesen, ganz selbstverständlich mitgeborgen in der Gesamtheit der geschöplichen Welt. Jetzt ist es herausgetreten aus dem Reigen der Dinge, steht im Vordergrund, und es hat sich zwischen ihm und allem Übrigen eine Kluft aufgetan, wahrlich nicht geringer als einst jene zwischen Himmel und Erde: nun ist das Ich und sein Schicksal der eigentliche Inhalt des Schöpferglaubens und das andre - es ist g e s c h a f f e n wie „ich” und doch, und doch...! es ist nur nebenbei da. Wer Martin Luthers Auslegung mit dem ersten Artikel des christlichen Glaubens vergleicht, der spürt den ganzen Unterschied einer Welt, die sich einfach in ein Oben und Unten, Himmel und Erde, teilt, und jener Welt, wie sie der Mensch der Neuzeit sieht; Ich - samt allen Kreaturen; ich - und die übrigen geschaffenen Dinge mir gegenüber. Das kleine Ich - es war immer dagewesen, ganz selbstverständlich mitgeborgen in der Gesamtheit der geschöplichen Welt. Jetzt ist es herausgetreten aus dem Reigen der Dinge, steht im Vordergrund, und es hat sich zwischen ihm und allem Übrigen eine Kluft aufgetan, wahrlich nicht geringer als einst jene zwischen Himmel und Erde: nun ist das Ich und sein Schicksal der eigentliche Inhalt des Schöpferglaubens und das andre - es ist g e s c h a f f e n wie „ich” und doch, und doch...! es ist nur nebenbei da.
 Samt allen Kreaturen! Es ist gar so kurz gesagt; was bedeutet das kleine Wörtlein „samt”? Wozu sind sie da, alle die Millionen Geschöpfe um mich her, und wieso bekennen wir, daß Gott auch ihr Schöpfer sei? Samt allen Kreaturen! Es ist gar so kurz gesagt; was bedeutet das kleine Wörtlein „samt”? Wozu sind sie da, alle die Millionen Geschöpfe um mich her, und wieso bekennen wir, daß Gott auch ihr Schöpfer sei?
 Wir brauchen nur in Luthers Erklärung des ersten Artikels weiterzulesen, um eines zu erkennen: diese Geschöpfe haben unmittelbare Bedeutung für meine Lage vor dem Schöpfer. Mein Leben ist von Anbeginn darauf gestellt, daß andere Dinge um mich her bestehen, die mir dienen müssen, mein eigenes Leben zu fristen: Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. So spricht es ja auch der biblische Schöpfungsbericht aus: Füllet die Erde u n d m a c h e t s i e e u c h u n t e r t a n und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht; sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamet, auf der ganzen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise! Wir brauchen nur in Luthers Erklärung des ersten Artikels weiterzulesen, um eines zu erkennen: diese Geschöpfe haben unmittelbare Bedeutung für meine Lage vor dem Schöpfer. Mein Leben ist von Anbeginn darauf gestellt, daß andere Dinge um mich her bestehen, die mir dienen müssen, mein eigenes Leben zu fristen: Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. So spricht es ja auch der biblische Schöpfungsbericht aus: Füllet die Erde u n d m a c h e t s i e e u c h u n t e r t a n und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht; sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamet, auf der ganzen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise!
 Die Welt als ein Werkzeug in der Hand des Menschen, um sein Leben zu gestalten, als ein Kraftfeld, dessen er sich technisch, d. h. als eines Hilfsmittels, bemächtigt, um alles in den Dienst seines Daseins, seines Wohlseins und seines Selbstbewußtseins zu stellen: das ist eine Art, den Kreaturen allen gegenüberzustehen, wie sie dem Menschen ohne Zweifel in die Wiege mitgegeben worden ist - in die Wiege seines Geschlechts, in den ersten vorgeschichtlichen Anfängen seines Daseins als Gattung, und in die Wiege jedes neugeborenen Kindleins unserer Tage: auftreten als Mensch heißt sich seinen Mitgeschöpfen gegenüber als den kommenden Herrn zeigen, der alles - kaputt macht, nämlich in seinen Machtbereich reißt, seines Eigendaseins beraubt und für seine Zwecke - letzten Endes - vernichtet. Die Welt als ein Werkzeug in der Hand des Menschen, um sein Leben zu gestalten, als ein Kraftfeld, dessen er sich technisch, d. h. als eines Hilfsmittels, bemächtigt, um alles in den Dienst seines Daseins, seines Wohlseins und seines Selbstbewußtseins zu stellen: das ist eine Art, den Kreaturen allen gegenüberzustehen, wie sie dem Menschen ohne Zweifel in die Wiege mitgegeben worden ist - in die Wiege seines Geschlechts, in den ersten vorgeschichtlichen Anfängen seines Daseins als Gattung, und in die Wiege jedes neugeborenen Kindleins unserer Tage: auftreten als Mensch heißt sich seinen Mitgeschöpfen gegenüber als den kommenden Herrn zeigen, der alles - kaputt macht, nämlich in seinen Machtbereich reißt, seines Eigendaseins beraubt und für seine Zwecke - letzten Endes - vernichtet.
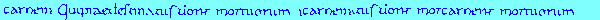
 Und doch steckt in dem „Samt allen Kreaturen” noch etwas anderes als die Ankündigung eines Herrschaftsanspruches, den die „Krone der Schöpfung” erhebt. Die Dinge der Welt sind hier ja Kreaturen genannt, Geschöpfe des einen Schöpfers. Damit ist ihnen eine Würde verliehen, die ihrer restlosen Unterwerfung unter den Machtwillen des Menschen wehrt. Denn das heißt ja wirklich nicht nur, daß ein gütiges Geschick es so gefügt hat, daß ein Sondergeschöpf andere Wesen zur Fristung seines Daseins und zum Spielball seiner Launen vorfindet, sondern „daß Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt”. Das heißt: sind es Geschöpfe, von Gott her uns geschenkte Umwelt, was uns umgibt, so ist jedes von ihnen für uns ein Zeugnis des Waltens Gottes, ganz abgesehen davon, ob es unserm Machtwillen dienstbar wird oder nicht, einfach durch sein Dasein. Dann stehen wir aber vor ihnen nicht nur unter dem Wort „Machet sie euch untertan”, sondern auch unter dem andern: „Gehet die Lilien auf dem Felde”. Gehet sie an - das heißt hier nicht: um zu merken, welche technisch-wirtschaftliche Möglichkeiten sie euerm Machthunger bieten, sondern ganz im Gegenteil: welche Schranken sie eurer Gottvergessenheit setzen, da ihr an ihnen sehen könnt, was es heißt, ein Geschöpf Gottes sein: geborgen sein in der väterlichen Sorge dessen, ohne den auch alle Sorge um Dasein und Macht ohnmächtig ist. Und doch steckt in dem „Samt allen Kreaturen” noch etwas anderes als die Ankündigung eines Herrschaftsanspruches, den die „Krone der Schöpfung” erhebt. Die Dinge der Welt sind hier ja Kreaturen genannt, Geschöpfe des einen Schöpfers. Damit ist ihnen eine Würde verliehen, die ihrer restlosen Unterwerfung unter den Machtwillen des Menschen wehrt. Denn das heißt ja wirklich nicht nur, daß ein gütiges Geschick es so gefügt hat, daß ein Sondergeschöpf andere Wesen zur Fristung seines Daseins und zum Spielball seiner Launen vorfindet, sondern „daß Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt”. Das heißt: sind es Geschöpfe, von Gott her uns geschenkte Umwelt, was uns umgibt, so ist jedes von ihnen für uns ein Zeugnis des Waltens Gottes, ganz abgesehen davon, ob es unserm Machtwillen dienstbar wird oder nicht, einfach durch sein Dasein. Dann stehen wir aber vor ihnen nicht nur unter dem Wort „Machet sie euch untertan”, sondern auch unter dem andern: „Gehet die Lilien auf dem Felde”. Gehet sie an - das heißt hier nicht: um zu merken, welche technisch-wirtschaftliche Möglichkeiten sie euerm Machthunger bieten, sondern ganz im Gegenteil: welche Schranken sie eurer Gottvergessenheit setzen, da ihr an ihnen sehen könnt, was es heißt, ein Geschöpf Gottes sein: geborgen sein in der väterlichen Sorge dessen, ohne den auch alle Sorge um Dasein und Macht ohnmächtig ist.
 Es handelt sich hier in diesem andersartigen Sehen auf die Geschöpfe nicht um müßige Gefühle einer poesiedurchzogenen Feierstunde, sondern um etwas, das ebenso ernsthaft und wesentlich, und ebenso alltagsbedeutsam hinter dem „Samt allen Kreaturen ” steht wie die technische Naturbetrachtung. Es handelt sich um das Denken im Gleichnis, oder besser: die Begegnung mit dem Schöpfer in seinen Geschöpfen. Dasselbe alltägliche, harterkämpfte Brot, das da spricht: nimm mich, sättige deinen Leib! - es fügt für den, der „des wahrnimmt”, hinzu: sich zu opfern ist Schöpfungsordnung. Das alltägliche, schlichte Wasser, das da spricht: nimm mich, erquicke dein Gemüt, reinige deinen Leib! - es fügt für den, dem es gegeben ist, es zu hören, hinzu: im Namen Christi - sei rein; stirb und werde! Der Blitz, der durch die Wolken zuckt, ruft dem Unermüdlichen zu: nimm mich, sessele mich, treib all deine Maschinen mit meiner Kraft! - aber er fügt dem Wissenden hinzu: doch hüte dich, ich komme aus eines Herren Hand, der mächtiger ist als all deine List und all dein übergroßer Fleiß. Es handelt sich hier in diesem andersartigen Sehen auf die Geschöpfe nicht um müßige Gefühle einer poesiedurchzogenen Feierstunde, sondern um etwas, das ebenso ernsthaft und wesentlich, und ebenso alltagsbedeutsam hinter dem „Samt allen Kreaturen ” steht wie die technische Naturbetrachtung. Es handelt sich um das Denken im Gleichnis, oder besser: die Begegnung mit dem Schöpfer in seinen Geschöpfen. Dasselbe alltägliche, harterkämpfte Brot, das da spricht: nimm mich, sättige deinen Leib! - es fügt für den, der „des wahrnimmt”, hinzu: sich zu opfern ist Schöpfungsordnung. Das alltägliche, schlichte Wasser, das da spricht: nimm mich, erquicke dein Gemüt, reinige deinen Leib! - es fügt für den, dem es gegeben ist, es zu hören, hinzu: im Namen Christi - sei rein; stirb und werde! Der Blitz, der durch die Wolken zuckt, ruft dem Unermüdlichen zu: nimm mich, sessele mich, treib all deine Maschinen mit meiner Kraft! - aber er fügt dem Wissenden hinzu: doch hüte dich, ich komme aus eines Herren Hand, der mächtiger ist als all deine List und all dein übergroßer Fleiß.
 Doch wir wollten von einem Sehen reden, das des Menschen Hand zur Ruhe bringt, daß er ganz Auge und ganz Ohr wird für eine Botschaft, die die Dinge bringen. Es handelt sich hier nicht nur um den Appell zur Dankbarkeit, den das tägliche Brot ausspricht, die Mahnung zur Vorsicht, die in der Übergewalt der Elemente liegt, auch nicht nur um den Aufruf zur Ehrfurcht, den man beim Aufblick zum bestirnten Himmel vernehmen kann. Es handelt sich darum, daß jedes Geschöpf seinen ganz besonderen Dienst tut in dem Werk einer Einführung des Menschen in die eigentlichen Geheimnisse des Lebens - Dinge, von denen eine Zeit um so mehr zu verstehen pflegt, je weniger sie in der technischen Beherrschung der Kreatur aufgeht, - von denen wir also sehr wenig wissen. Die Alten habens etwa so gesagt, daß wir an den Pflanzen die Tugenden, an den Tieren die Laster menschlichen Wesens anschauen sollen. Am unmittelbarsten ist etwas davon wirklich, wenn der Städter in die „Natur” hinausgeht und hier einer Welt begegnet, die ihm zu tiefst wohltut, nicht nur wie eine fremde Stadt auf der Vergnügungsreise, weil sie ihm nicht zum wirtschaftlichen Kampffeld wird, sondern als ein Bereich des Schöpferwirkens, als eine Wirklichkeit, die an Stelle des menschlichen Fabrikationstempels das Zeichen eines Ursprungslandes trägt, das auch für ihn selbst Heimat ist - aber eine verlorene Heimat: es ist die „paradiesische Schönheit der Natur”. Doch wir wollten von einem Sehen reden, das des Menschen Hand zur Ruhe bringt, daß er ganz Auge und ganz Ohr wird für eine Botschaft, die die Dinge bringen. Es handelt sich hier nicht nur um den Appell zur Dankbarkeit, den das tägliche Brot ausspricht, die Mahnung zur Vorsicht, die in der Übergewalt der Elemente liegt, auch nicht nur um den Aufruf zur Ehrfurcht, den man beim Aufblick zum bestirnten Himmel vernehmen kann. Es handelt sich darum, daß jedes Geschöpf seinen ganz besonderen Dienst tut in dem Werk einer Einführung des Menschen in die eigentlichen Geheimnisse des Lebens - Dinge, von denen eine Zeit um so mehr zu verstehen pflegt, je weniger sie in der technischen Beherrschung der Kreatur aufgeht, - von denen wir also sehr wenig wissen. Die Alten habens etwa so gesagt, daß wir an den Pflanzen die Tugenden, an den Tieren die Laster menschlichen Wesens anschauen sollen. Am unmittelbarsten ist etwas davon wirklich, wenn der Städter in die „Natur” hinausgeht und hier einer Welt begegnet, die ihm zu tiefst wohltut, nicht nur wie eine fremde Stadt auf der Vergnügungsreise, weil sie ihm nicht zum wirtschaftlichen Kampffeld wird, sondern als ein Bereich des Schöpferwirkens, als eine Wirklichkeit, die an Stelle des menschlichen Fabrikationstempels das Zeichen eines Ursprungslandes trägt, das auch für ihn selbst Heimat ist - aber eine verlorene Heimat: es ist die „paradiesische Schönheit der Natur”.
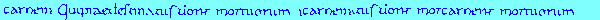
 Wie ist es möglich, daß der naturschwärmende Städter nicht nur alle Forst- und Landwirtschaft auf der Seite läßt, sondern auch an dem Kampf ums Dasein vorbeisieht, der in der Tier- und Pflanzenwelt um ihn tobt - kaum weniger grausam als im Bereich des Menschen? Das ist möglich, weil dieser Kampf hier draußen frei ist von jenem besonderen Gift, das die Bewußtheit des Menschen hineinträgt; weil er ohne Haß und Gunst, weil er ohne Schuld und ohne Verstellung geführt wird. Der Naturfreund mag sich über vieles täuschen - er hat dennoch recht, weil unter alledem, was da um ihn vorgeht, eines ihn angeht: daß es da Kreatur gibt, die in reinerem Sinne als er Kreatur ist; daß es da Kreatur gibt, die nicht den Fluch der Adamsschuld trägt, mag sie unter dessen Folgen noch so sehr mitleiden müssen. Er sieht es: es gibt Reinheit von dem, was das menschliche Leben zerstört; erhört es rufen: kehre heim zum reinen Ursprung. Und da versinken alle Erwägungen der Weltbeherrschung und der Weltkritik und es öffnet sich ihm eine Welt, aus der er sonst verstoßen ist. Wie ist es möglich, daß der naturschwärmende Städter nicht nur alle Forst- und Landwirtschaft auf der Seite läßt, sondern auch an dem Kampf ums Dasein vorbeisieht, der in der Tier- und Pflanzenwelt um ihn tobt - kaum weniger grausam als im Bereich des Menschen? Das ist möglich, weil dieser Kampf hier draußen frei ist von jenem besonderen Gift, das die Bewußtheit des Menschen hineinträgt; weil er ohne Haß und Gunst, weil er ohne Schuld und ohne Verstellung geführt wird. Der Naturfreund mag sich über vieles täuschen - er hat dennoch recht, weil unter alledem, was da um ihn vorgeht, eines ihn angeht: daß es da Kreatur gibt, die in reinerem Sinne als er Kreatur ist; daß es da Kreatur gibt, die nicht den Fluch der Adamsschuld trägt, mag sie unter dessen Folgen noch so sehr mitleiden müssen. Er sieht es: es gibt Reinheit von dem, was das menschliche Leben zerstört; erhört es rufen: kehre heim zum reinen Ursprung. Und da versinken alle Erwägungen der Weltbeherrschung und der Weltkritik und es öffnet sich ihm eine Welt, aus der er sonst verstoßen ist.
 Der Techniker im Menschen merkt, daß diese „zweiten Stimmen”, wenn sie wirklich mächtig werden, ihm hinderlich sind in der rücksichtslosen Unterwerfung der Welt, daß sie je und je den Menschen davon zurückgehalten haben, sich eine Naturmacht zunutze zu machen. Darum möchte er sie für unwirklich erklären und zu einer Spielerei müßiger Stunden erniedrigen, die „eigentlich” nichts zu bedeuten hat. Aber es geht nicht. Der Mensch müßte aufhören zu sprechen, wenn er aufhören wollte, von dem Geheimnis in den Dingen, von dem, was nicht nur Mittel in der Hand des Menschen ist, zu zeugen. Gold ist eben nicht nur ein chemisches Element von großer weltwirtschaftlicher Bedeutung, sondern die Offenbarung einer Gefahr, die in allem stofflichen Besitz lauert, und zugleich eines Geborgenseins vor irdischer Vergänglichkeit, das es sonst auf Erden nicht gibt. Die Sonne ist eben nicht nur ein Kraftzentrum von entscheidender Bedeutung für alles organische Leben, sondern zugleich das unentbehrliche Bild des Sieges über die Bedingtheiten des toten wie des lebenden Stoffes. Die Zahl „drei” ist eben durchaus keine bloße Erfindung des Existenzkampfes, sondern zugleich ein Urbild der geordneten, zeugungskräftigen Fülle. Der Techniker im Menschen merkt, daß diese „zweiten Stimmen”, wenn sie wirklich mächtig werden, ihm hinderlich sind in der rücksichtslosen Unterwerfung der Welt, daß sie je und je den Menschen davon zurückgehalten haben, sich eine Naturmacht zunutze zu machen. Darum möchte er sie für unwirklich erklären und zu einer Spielerei müßiger Stunden erniedrigen, die „eigentlich” nichts zu bedeuten hat. Aber es geht nicht. Der Mensch müßte aufhören zu sprechen, wenn er aufhören wollte, von dem Geheimnis in den Dingen, von dem, was nicht nur Mittel in der Hand des Menschen ist, zu zeugen. Gold ist eben nicht nur ein chemisches Element von großer weltwirtschaftlicher Bedeutung, sondern die Offenbarung einer Gefahr, die in allem stofflichen Besitz lauert, und zugleich eines Geborgenseins vor irdischer Vergänglichkeit, das es sonst auf Erden nicht gibt. Die Sonne ist eben nicht nur ein Kraftzentrum von entscheidender Bedeutung für alles organische Leben, sondern zugleich das unentbehrliche Bild des Sieges über die Bedingtheiten des toten wie des lebenden Stoffes. Die Zahl „drei” ist eben durchaus keine bloße Erfindung des Existenzkampfes, sondern zugleich ein Urbild der geordneten, zeugungskräftigen Fülle.
 Will der Mensch das nicht mehr wahrhaben, ist ihm alles nur mehr soweit wirklich, als es Mittel für seine Macht geworden ist: dann hat er keinen Zweck mehr, dem er alle seine Mittel dienstbar machen könnte, und dann - was wird aus einem Feldherrn, der über ein großes Heer verfügt, aber keine Kampfziele hat, für die er es einsetzen könnte? Das Heer wird eines Tages rebellieren und ihn stürzen, wenn er sich nicht schon vorher dazu bequemt, sich denen zu unterwerfen, die für ihn sterben sollten, Kennen wir das nicht alle: diesen Menschen, der über viel mehr Mittel verfügt als er Zwecke kennt, für die es sich lohnte, sie einzusetzen? Richtiger: Mittel sein eigen nennt, die über ihn verfügen? Denn er ist in solchem Falle der Sklave seiner eigenen Macht. Ach, dieser versklavte Herr, er ist ja keine Einzelerscheinung, sondern das Bild unsrer Zeit. Haben wir nicht, wir Kulturmenschen, eine unheimliche Gewalt über die Schöpfung gewonnen, an uns gerissen, erlistet - und werden kaum satt davon, weil die Mittel nicht für einen gültigen letzten Zweck eingesetzt werden, sondern nur dazu dienen, uns einen Machtrausch zu schenken, der unstillbar ist, weil er kein Ziel hat? Will der Mensch das nicht mehr wahrhaben, ist ihm alles nur mehr soweit wirklich, als es Mittel für seine Macht geworden ist: dann hat er keinen Zweck mehr, dem er alle seine Mittel dienstbar machen könnte, und dann - was wird aus einem Feldherrn, der über ein großes Heer verfügt, aber keine Kampfziele hat, für die er es einsetzen könnte? Das Heer wird eines Tages rebellieren und ihn stürzen, wenn er sich nicht schon vorher dazu bequemt, sich denen zu unterwerfen, die für ihn sterben sollten, Kennen wir das nicht alle: diesen Menschen, der über viel mehr Mittel verfügt als er Zwecke kennt, für die es sich lohnte, sie einzusetzen? Richtiger: Mittel sein eigen nennt, die über ihn verfügen? Denn er ist in solchem Falle der Sklave seiner eigenen Macht. Ach, dieser versklavte Herr, er ist ja keine Einzelerscheinung, sondern das Bild unsrer Zeit. Haben wir nicht, wir Kulturmenschen, eine unheimliche Gewalt über die Schöpfung gewonnen, an uns gerissen, erlistet - und werden kaum satt davon, weil die Mittel nicht für einen gültigen letzten Zweck eingesetzt werden, sondern nur dazu dienen, uns einen Machtrausch zu schenken, der unstillbar ist, weil er kein Ziel hat?
 Wann wäre auch des Menschen Macht so groß, daß seine Seele davon satt werden könnte, Macht zu haben - ohne zu wissen, wofür diese Macht dienen soll? So häufen sich die Mittel, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die technischen Kräfte, die klugen Berechnungen, und wenden sich gegen ihren Herren, als Wesen, die ihrem letzten Herren, dem Schöpfer, entfremdet sind, und nun in widergöttlichem Für-sich-Sein ein Tummelplatz teuflischer Mächte werden. Peinigen den Menschen durch die Entsetzlichkeit ihrer zerstörerischen Kräfte in Katastrophen der Natur und der Technik; peinigen ihn durch die ständige Drohung dieser ihrer Übermacht am friedlichsten Alltag; peinigen durch die Leere des Wozu? Wozu das alles? Peinigen ihn durch den Hohn ihrer „dritten Stimme”: Wann wäre auch des Menschen Macht so groß, daß seine Seele davon satt werden könnte, Macht zu haben - ohne zu wissen, wofür diese Macht dienen soll? So häufen sich die Mittel, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die technischen Kräfte, die klugen Berechnungen, und wenden sich gegen ihren Herren, als Wesen, die ihrem letzten Herren, dem Schöpfer, entfremdet sind, und nun in widergöttlichem Für-sich-Sein ein Tummelplatz teuflischer Mächte werden. Peinigen den Menschen durch die Entsetzlichkeit ihrer zerstörerischen Kräfte in Katastrophen der Natur und der Technik; peinigen ihn durch die ständige Drohung dieser ihrer Übermacht am friedlichsten Alltag; peinigen durch die Leere des Wozu? Wozu das alles? Peinigen ihn durch den Hohn ihrer „dritten Stimme”:
Wenn du unser Wort überhörst
und die Herrschaft über uns zur Sklaverei machst,
dadurch daß du selbst nicht mehr um die Zwecke weißt,
für die wir dir gegeben sind:
dann werde ich, das Brot dir Gift sein,
daß du in der Üppigkeit und sinnlosen Verkünstelung
deiner Nahrungsgenüsse verfaulst und verdirbst;
dann werde ich, das Wasser,deiner Kanäle spotten
und dein Werk überfluten,
deine Seele aber in ihrem Staub vertrocknen lassen;
dann werde ich, der Blitz, aus allen meinen Fesseln fahren
und du wirst erstarren vor der Allgewalt dessen,
vor dem all dein Wesen ein Nichts ist.
 Dreierlei Stimmen haben wir unterschieden, in denen die Stellung der Kreatur zum Menschen zum Ausdruck kam. Enthalten sie alles, was über die Kreatur zu sagen ist? Dann offenbarte auch die zweite und dritte Stimme nichts anderes, als die erste: daß die Welt um des Menschen willen da ist. Ob als Mittel zur Macht, oder als Wegweiser und Warner (oder endlich als Verführer) auf einem Wege, der ins Jenseits der Dinge führt, immer entlehnten die Geschöpfe ihren Daseinssinn dann vom Menschen, ohne den sie nicht wären. Die Welt zerfiele in den selbstwertigen Menschen auf der einen und die für ihn geschaffenen Kreaturen auf der andern Seite. Das hieße aber, daß es im Grunde doch nur e i n Geschöpf, nur e i n e n Gedanken Gottes gäbe. Die Kreatur außer dem Menschen wäre von solcher Unmittelbarkeit zu Gott ausgeschlossen. Dreierlei Stimmen haben wir unterschieden, in denen die Stellung der Kreatur zum Menschen zum Ausdruck kam. Enthalten sie alles, was über die Kreatur zu sagen ist? Dann offenbarte auch die zweite und dritte Stimme nichts anderes, als die erste: daß die Welt um des Menschen willen da ist. Ob als Mittel zur Macht, oder als Wegweiser und Warner (oder endlich als Verführer) auf einem Wege, der ins Jenseits der Dinge führt, immer entlehnten die Geschöpfe ihren Daseinssinn dann vom Menschen, ohne den sie nicht wären. Die Welt zerfiele in den selbstwertigen Menschen auf der einen und die für ihn geschaffenen Kreaturen auf der andern Seite. Das hieße aber, daß es im Grunde doch nur e i n Geschöpf, nur e i n e n Gedanken Gottes gäbe. Die Kreatur außer dem Menschen wäre von solcher Unmittelbarkeit zu Gott ausgeschlossen.
 Sollten wir nicht argwöhnisch sein gegen ein Weltbild, in dem sich so sehr alles um uns selbst dreht? Sollte es nicht der alte Machtwille sein, der uns alle Geschöpfe vergewaltigen ließ im Naturbeherrschungskampf, der uns jetzt auch davon träumen läßt, als seien Tier und Pflanze, Erden und Sterne nur dazu da, uns Kunde zu geben, uns Wege zu weisen, uns zu trösten und zu vermahnen, allenfalls mit der Möglichkeit, statt uns zu dienen, ihren Lebenszweck in unserer Irreführung und Verlockung ins Unheil zu suchen? Wäre es nicht edler, zuzugeben, daß alle Geschöpfe - wirklich Geschöpfe sind, leibgewordene Gedanken Gottes, Wesen, die Sinn und Ziel ihres Daseins in sich selbst tragen und nicht erst von uns erborgen müssen? Gibt es nicht ein Erforschen der Natur, bei dem der Mensch sich selbst ganz vergißt, seine Machtziele und vielleicht sogar seine seelischen Bedürfnisse, und nur darüber staunen lernt, was alles neben ihm da ist? Kann man da nicht Blicke tun in eine Fülle, die so groß ist, daß schon eher der Mensch die Nebensache, die Natur draußen aber das große wirkliche Leben wird, in dem er verschwindet und untergeht? In der Tat, es haben Gelehrte die Sternenwelten durchsucht und durchrechnet, und der Gedanke ans Kalendermachen für den menschlichen Jahrmarkt ist ihnen vergangen: gerade die völlige Zwecklosigkeit all dieser unendlichen Dinge hat sie verstummen gemacht und anbeten gelehrt. Sollten wir nicht argwöhnisch sein gegen ein Weltbild, in dem sich so sehr alles um uns selbst dreht? Sollte es nicht der alte Machtwille sein, der uns alle Geschöpfe vergewaltigen ließ im Naturbeherrschungskampf, der uns jetzt auch davon träumen läßt, als seien Tier und Pflanze, Erden und Sterne nur dazu da, uns Kunde zu geben, uns Wege zu weisen, uns zu trösten und zu vermahnen, allenfalls mit der Möglichkeit, statt uns zu dienen, ihren Lebenszweck in unserer Irreführung und Verlockung ins Unheil zu suchen? Wäre es nicht edler, zuzugeben, daß alle Geschöpfe - wirklich Geschöpfe sind, leibgewordene Gedanken Gottes, Wesen, die Sinn und Ziel ihres Daseins in sich selbst tragen und nicht erst von uns erborgen müssen? Gibt es nicht ein Erforschen der Natur, bei dem der Mensch sich selbst ganz vergißt, seine Machtziele und vielleicht sogar seine seelischen Bedürfnisse, und nur darüber staunen lernt, was alles neben ihm da ist? Kann man da nicht Blicke tun in eine Fülle, die so groß ist, daß schon eher der Mensch die Nebensache, die Natur draußen aber das große wirkliche Leben wird, in dem er verschwindet und untergeht? In der Tat, es haben Gelehrte die Sternenwelten durchsucht und durchrechnet, und der Gedanke ans Kalendermachen für den menschlichen Jahrmarkt ist ihnen vergangen: gerade die völlige Zwecklosigkeit all dieser unendlichen Dinge hat sie verstummen gemacht und anbeten gelehrt.
 Und es haben Gelehrte und Ungelehrte die Gestaltenfülle des organischen Lebens, wie es die Erde in vergangenen Zeitaltern und in der Gegenwart bevölkert, vor sich ausgebreitet, und haben wirtschaftliche Ausnützungspläne vergessen und schließlich sogar den Stolz des Vielwissens abgelegt und mit Hiob gesprochen: Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ja, es gibt eine Ahnung, daß die Welt nicht nur um des Menschen willen da ist Aber es ist eine gefährliche Ahnung. Hier sind wir, und sollen aus der Kreatur Kraft und Weisung nehmen - und werden mit dieser Aufgabe nicht fertig, verkommen fast in unsern Nöten - und dort ist das Reich von Tausenden von Geschöpfen, die i h r e n Weg gehen, ein Schauspiel voller Wunder und Geheimnisse, daß unsre kleinen Sorgen davor verschwinden - wer sollte bei diesem Anblick nicht zu fliehen versuchen aus u n s r e r Not und anbetend versinken im Wunder der fremden Welten um uns her - und was wäre es anderes als Untreue gegen unsern Auftrag, in dessen Dienst unser Leben allein die Verheißung eines ewigen Zieles hat, Untreue gegen den Sinn unsers Lebens? Die Grenzen, die uns gesteckt sind, wären damit überschritten, das Werk versäumt, das uns geziemt. Und es haben Gelehrte und Ungelehrte die Gestaltenfülle des organischen Lebens, wie es die Erde in vergangenen Zeitaltern und in der Gegenwart bevölkert, vor sich ausgebreitet, und haben wirtschaftliche Ausnützungspläne vergessen und schließlich sogar den Stolz des Vielwissens abgelegt und mit Hiob gesprochen: Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ja, es gibt eine Ahnung, daß die Welt nicht nur um des Menschen willen da ist Aber es ist eine gefährliche Ahnung. Hier sind wir, und sollen aus der Kreatur Kraft und Weisung nehmen - und werden mit dieser Aufgabe nicht fertig, verkommen fast in unsern Nöten - und dort ist das Reich von Tausenden von Geschöpfen, die i h r e n Weg gehen, ein Schauspiel voller Wunder und Geheimnisse, daß unsre kleinen Sorgen davor verschwinden - wer sollte bei diesem Anblick nicht zu fliehen versuchen aus u n s r e r Not und anbetend versinken im Wunder der fremden Welten um uns her - und was wäre es anderes als Untreue gegen unsern Auftrag, in dessen Dienst unser Leben allein die Verheißung eines ewigen Zieles hat, Untreue gegen den Sinn unsers Lebens? Die Grenzen, die uns gesteckt sind, wären damit überschritten, das Werk versäumt, das uns geziemt.
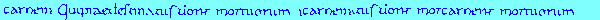
 Wohin sollen wir uns wenden? Lassen wir die Welt sich um uns selbst drehen, so ergreift uns der Taumel der Überhebung; blicken wir über unsern menschlichen Kreis hinaus, dann saugt uns die Übermacht der unendlichen Fülle in ihren Strudel und verschlingt uns. In dieser Not fragen wir nach der Entscheidung derer, die vor uns in dieser Not gestanden, und finden sie niedergelegt auf den Blättern des Neuen Testaments. Wohin sollen wir uns wenden? Lassen wir die Welt sich um uns selbst drehen, so ergreift uns der Taumel der Überhebung; blicken wir über unsern menschlichen Kreis hinaus, dann saugt uns die Übermacht der unendlichen Fülle in ihren Strudel und verschlingt uns. In dieser Not fragen wir nach der Entscheidung derer, die vor uns in dieser Not gestanden, und finden sie niedergelegt auf den Blättern des Neuen Testaments.
 Im Gegensatz zu dem, was das Alte Testament etwa über die Gottesbegegnung eines Hiob zu sagen weiß (lies das Hiobbuch vom 38. Kapitel an!), kennt das Neue Testament die Anbetung Gottes im Schauen auf die übermächtige Größe der Geschöpfe, und das heißt im Vergessen unseres menschlichen Schicksals, ganz und gar nicht. Im Gegensatz zu dem, was das Alte Testament etwa über die Gottesbegegnung eines Hiob zu sagen weiß (lies das Hiobbuch vom 38. Kapitel an!), kennt das Neue Testament die Anbetung Gottes im Schauen auf die übermächtige Größe der Geschöpfe, und das heißt im Vergessen unseres menschlichen Schicksals, ganz und gar nicht.
 Von allen Kreaturen redet es nur da, wo sie dem Menschen etwas für seine Befreiung aus Not und Schuld zu sagen haben; für die Tiere selbst hat es kaum einen Seitenblick - ein Hindu kümmert sich mehr um sie als alle Apostel zusammen. Immer nur der Mensch, seine Not und seine Befreiung. Bringt es nicht ein Paulus fertig zu schreiben: Von allen Kreaturen redet es nur da, wo sie dem Menschen etwas für seine Befreiung aus Not und Schuld zu sagen haben; für die Tiere selbst hat es kaum einen Seitenblick - ein Hindu kümmert sich mehr um sie als alle Apostel zusammen. Immer nur der Mensch, seine Not und seine Befreiung. Bringt es nicht ein Paulus fertig zu schreiben:
 Im Gesetz Moses steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Sorgt Gott für die Ochsen? Oder sagt ers nicht allerdings um unsertwillen? ... So wir euch das Geistliche säen, ists ein groß Ding, wenn wir euer Leibliches ernten? Im Gesetz Moses steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Sorgt Gott für die Ochsen? Oder sagt ers nicht allerdings um unsertwillen? ... So wir euch das Geistliche säen, ists ein groß Ding, wenn wir euer Leibliches ernten?
 Derselbe Mann, der das Seufzen der Kreatur um uns her nach Erlösung vernommen hat wie kein andrer - „Sorgt Gott für die Ochsen?” Derselbe Mann, der das Seufzen der Kreatur um uns her nach Erlösung vernommen hat wie kein andrer - „Sorgt Gott für die Ochsen?”
 Warum das, warum diese entsetzliche Enge, daß man aus Tier- und Pflanzen- und Sternenwelt nur eine Hieroglyphenschrift macht für uns? Macht es da noch viel aus, ob man die Geheimzeichen zu unsrer Belehrung (in der allegorischen Theologie) oder zur Unterhaltung der Neugier gebraucht (in der Wahrsagerei)? Warum das, warum diese entsetzliche Enge, daß man aus Tier- und Pflanzen- und Sternenwelt nur eine Hieroglyphenschrift macht für uns? Macht es da noch viel aus, ob man die Geheimzeichen zu unsrer Belehrung (in der allegorischen Theologie) oder zur Unterhaltung der Neugier gebraucht (in der Wahrsagerei)?
 Nun, die Männer des Neuen Testaments haben Grund, uns nichts anderes zuzutrauen als die Entzifferung solcher für unsern Gebrauch geschriebenen Hieroglyphen! Sie wissen, wie niemand sonst, um den Abgrund der Not, in der wir stecken. Sie wissen, daß wir in Gefahr sind, uns diese Not zu verbergen, und daß wir dieser Not nicht Herr werden, wenn wir nicht alle Kraft sammeln auf den Kampf um unser Schicksal. Wir dürfen und können nicht Muße haben, uns nach dem geheimen Sinn des Daseins andrer Geschöpfe umzusehen: „Errette deine Seele und sieh nicht hinter dich!” Die Geschöpfe mögen für sich einen solchen Sinn ihres Lebens haben, ja, sie haben ihn, denn sie sind geschaffen. Aber uns geht das nicht an. Wir haben dem Fluch stille zu halten, der über uns seit Adam ergangen ist, oder richtiger: uns aus diesem Fluch herauszuarbeiten - wir können nicht auch noch das Schicksal anderer Welten auf uns nehmen. Es ist also nicht Überheblichkeit, wenn in der Nachfolge Christi nicht gefragt wird darnach, was das Leben der Blumen und der Kristalle und der Tiere und aller Gestirne in sich, abgesehen davon, daß sie für unser Leben dies und das bedeuten, was es abgesehen davon für einen Sinn, was für ein besonderes Ziel haben mag. Es ist nicht Überheblichkeit, es ist Bescheidung. Nun, die Männer des Neuen Testaments haben Grund, uns nichts anderes zuzutrauen als die Entzifferung solcher für unsern Gebrauch geschriebenen Hieroglyphen! Sie wissen, wie niemand sonst, um den Abgrund der Not, in der wir stecken. Sie wissen, daß wir in Gefahr sind, uns diese Not zu verbergen, und daß wir dieser Not nicht Herr werden, wenn wir nicht alle Kraft sammeln auf den Kampf um unser Schicksal. Wir dürfen und können nicht Muße haben, uns nach dem geheimen Sinn des Daseins andrer Geschöpfe umzusehen: „Errette deine Seele und sieh nicht hinter dich!” Die Geschöpfe mögen für sich einen solchen Sinn ihres Lebens haben, ja, sie haben ihn, denn sie sind geschaffen. Aber uns geht das nicht an. Wir haben dem Fluch stille zu halten, der über uns seit Adam ergangen ist, oder richtiger: uns aus diesem Fluch herauszuarbeiten - wir können nicht auch noch das Schicksal anderer Welten auf uns nehmen. Es ist also nicht Überheblichkeit, wenn in der Nachfolge Christi nicht gefragt wird darnach, was das Leben der Blumen und der Kristalle und der Tiere und aller Gestirne in sich, abgesehen davon, daß sie für unser Leben dies und das bedeuten, was es abgesehen davon für einen Sinn, was für ein besonderes Ziel haben mag. Es ist nicht Überheblichkeit, es ist Bescheidung.
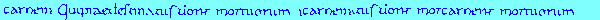
 Darum brauchen wir durchaus nicht zu leugnen, daß sie echte Werke Gottes sind und gleich uns für die Ewigkeit geschaffen, - sondern wir bekennen es vielmehr ehrfürchtig; wir brauchen auch nicht die Verbundenheit zu leugnen, die trotz unseres Nichtwissens um ihr letztes Ziel zwischen uns und ihnen besteht: daß sie eine Seite ihres Wesens haben, die uns zugewandt ist, ein Für-uns-Sein, um dessentwillen wir für ihr Dasein danken können; ja daß sie hereingezogen sind in unsern Fall und unter unsrer Gottentfremdung mit zu leiden haben, daß sie aber gleich uns berufen sind zur Wiederherstellung ihrer reinen Geschöplichkeit in einer erneuerten Welt. Gewiß, in dem Maße, als wir selbst unsrer Not Herr werden, werden wir auch den Geschöpfen etwas sein dürfen. Aber es besteht doch immer die Gefahr, daß wir mit der Frage nach dem, was das Leben der Geschöpfe, von innen gesehen, wohl ausfüllen möchte, nur den Versuch machen, aus der eignen Lebensaufgabe um ihrer Not willen zu flüchten und also vorm Feinde die Fahne zu verlassen. Gerade wer darum weiß, daß alle Geschöpfe G e s c h ö p f e G o t t e s sind, braucht solche Fragen im einzelnen auch gar nicht zu stellen - er weiß, daß für jeden eine eigene Aufgabe da ist, wie für ihn, so für alle Kreatur. Darum brauchen wir durchaus nicht zu leugnen, daß sie echte Werke Gottes sind und gleich uns für die Ewigkeit geschaffen, - sondern wir bekennen es vielmehr ehrfürchtig; wir brauchen auch nicht die Verbundenheit zu leugnen, die trotz unseres Nichtwissens um ihr letztes Ziel zwischen uns und ihnen besteht: daß sie eine Seite ihres Wesens haben, die uns zugewandt ist, ein Für-uns-Sein, um dessentwillen wir für ihr Dasein danken können; ja daß sie hereingezogen sind in unsern Fall und unter unsrer Gottentfremdung mit zu leiden haben, daß sie aber gleich uns berufen sind zur Wiederherstellung ihrer reinen Geschöplichkeit in einer erneuerten Welt. Gewiß, in dem Maße, als wir selbst unsrer Not Herr werden, werden wir auch den Geschöpfen etwas sein dürfen. Aber es besteht doch immer die Gefahr, daß wir mit der Frage nach dem, was das Leben der Geschöpfe, von innen gesehen, wohl ausfüllen möchte, nur den Versuch machen, aus der eignen Lebensaufgabe um ihrer Not willen zu flüchten und also vorm Feinde die Fahne zu verlassen. Gerade wer darum weiß, daß alle Geschöpfe G e s c h ö p f e G o t t e s sind, braucht solche Fragen im einzelnen auch gar nicht zu stellen - er weiß, daß für jeden eine eigene Aufgabe da ist, wie für ihn, so für alle Kreatur.
 Je mehr wir hier eine Grenze anerkennen, über die wir nicht ungestraft hinausgehen, um so mehr haben wir Grund, auf d i e Stimmen der Geschöpfe zu horchen, die sie uns zurufen, und die unsre eigne Lebensaufgabe betreffen. Weil wir über dem Bestreben der Weltordnung dies Lauschen auf das Geheimnis der Kreatur arg verlernt haben, so dürfen wir jetzt alle Sinne weit auftun, um die tausendfältige Botschaft in uns zu saugen, die da von Himmel und Erde auf uns eindringt. Was man da längst in die Schlupfwinkel der Poesie verbannt glaubte, darf wieder etwas bedeuten in unserm Leben: daß wir an den Pflanzen die Tugenden neidlosen In-sich-Ruhens, an den Tieren die Laster leidenschaftlicher Verblendung, im Kinde (als Erwachsene) etwas von paradiesischer Unschuld, im reifen Menschen (als Heranwachsende) etwas von göttlicher Vaterschaft vorgebildet, d. h. vor uns hin als ein Bild gestellt sehen, in das wir uns versenken, dem wir nacharten dürfen. Nun heißt es nicht, das Kind verhimmeln, wenn man an ihm den verheißungsvollen Ruf zu heiliger Kindschaft vernimmt. Nun heißt es nicht, das Tier schänden, wenn man diese und jene Gattung zum Sinnbild der Unreinheit oder Feigheit macht. Nach Gottes wunderbarem Rat kann das Tier uns durch sein Wesen die Schlechtigkeit eines Lasters vorhalten, von dem es für sich frei ist, - und ist doch nicht Willkür, daß wir das so sehen, es tut uns diesen Dienst von Amts wegen und ohne eignen Makel. Je mehr wir hier eine Grenze anerkennen, über die wir nicht ungestraft hinausgehen, um so mehr haben wir Grund, auf d i e Stimmen der Geschöpfe zu horchen, die sie uns zurufen, und die unsre eigne Lebensaufgabe betreffen. Weil wir über dem Bestreben der Weltordnung dies Lauschen auf das Geheimnis der Kreatur arg verlernt haben, so dürfen wir jetzt alle Sinne weit auftun, um die tausendfältige Botschaft in uns zu saugen, die da von Himmel und Erde auf uns eindringt. Was man da längst in die Schlupfwinkel der Poesie verbannt glaubte, darf wieder etwas bedeuten in unserm Leben: daß wir an den Pflanzen die Tugenden neidlosen In-sich-Ruhens, an den Tieren die Laster leidenschaftlicher Verblendung, im Kinde (als Erwachsene) etwas von paradiesischer Unschuld, im reifen Menschen (als Heranwachsende) etwas von göttlicher Vaterschaft vorgebildet, d. h. vor uns hin als ein Bild gestellt sehen, in das wir uns versenken, dem wir nacharten dürfen. Nun heißt es nicht, das Kind verhimmeln, wenn man an ihm den verheißungsvollen Ruf zu heiliger Kindschaft vernimmt. Nun heißt es nicht, das Tier schänden, wenn man diese und jene Gattung zum Sinnbild der Unreinheit oder Feigheit macht. Nach Gottes wunderbarem Rat kann das Tier uns durch sein Wesen die Schlechtigkeit eines Lasters vorhalten, von dem es für sich frei ist, - und ist doch nicht Willkür, daß wir das so sehen, es tut uns diesen Dienst von Amts wegen und ohne eignen Makel.
 Wir werden viel verlorene Erkenntnis dieser Art wiedergewinnen müssen, die uns jetzt fehlt. Daß wir nur darüber uns nicht verlieren in eine Art des Wissenserwerbs, die aus der Not des wirklichen Lebens in die Schätze des Wissens flieht; und daß wir zugleich nicht vergessen, daß wir trotz allem nicht der Mittelpunkt der Welt sind, sondern nur der Mittelpunkt unsrer eignen Aufgabe. Einen Gott haben, heißt, in einer Welt stehen, deren Grenzen wir nicht abstecken, deren Ziele wir nicht ausschöpfen, deren Herrschaft wir nicht an uns reißen können; einen Gott haben, heißt aber zugleich, in einer Welt stehen, deren Glieder mit uns da sind und - neben ihrem eignen Ziel - für uns da sind, und mit denen wir darum jenseits menschlichen Machtstrebens und menschlichen Wissenskampfes dennoch verbunden sind als mit Brüdern und Schwestern eines Vaters. Das bedeutet es, wenn wir sprechen: Wir werden viel verlorene Erkenntnis dieser Art wiedergewinnen müssen, die uns jetzt fehlt. Daß wir nur darüber uns nicht verlieren in eine Art des Wissenserwerbs, die aus der Not des wirklichen Lebens in die Schätze des Wissens flieht; und daß wir zugleich nicht vergessen, daß wir trotz allem nicht der Mittelpunkt der Welt sind, sondern nur der Mittelpunkt unsrer eignen Aufgabe. Einen Gott haben, heißt, in einer Welt stehen, deren Grenzen wir nicht abstecken, deren Ziele wir nicht ausschöpfen, deren Herrschaft wir nicht an uns reißen können; einen Gott haben, heißt aber zugleich, in einer Welt stehen, deren Glieder mit uns da sind und - neben ihrem eignen Ziel - für uns da sind, und mit denen wir darum jenseits menschlichen Machtstrebens und menschlichen Wissenskampfes dennoch verbunden sind als mit Brüdern und Schwestern eines Vaters. Das bedeutet es, wenn wir sprechen:
 Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat - samt allen Kreaturen. Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat - samt allen Kreaturen.
Das Gottesjahr 1932, S. 42-50
© Bärenreiter-Verlag zu Kassel
|

